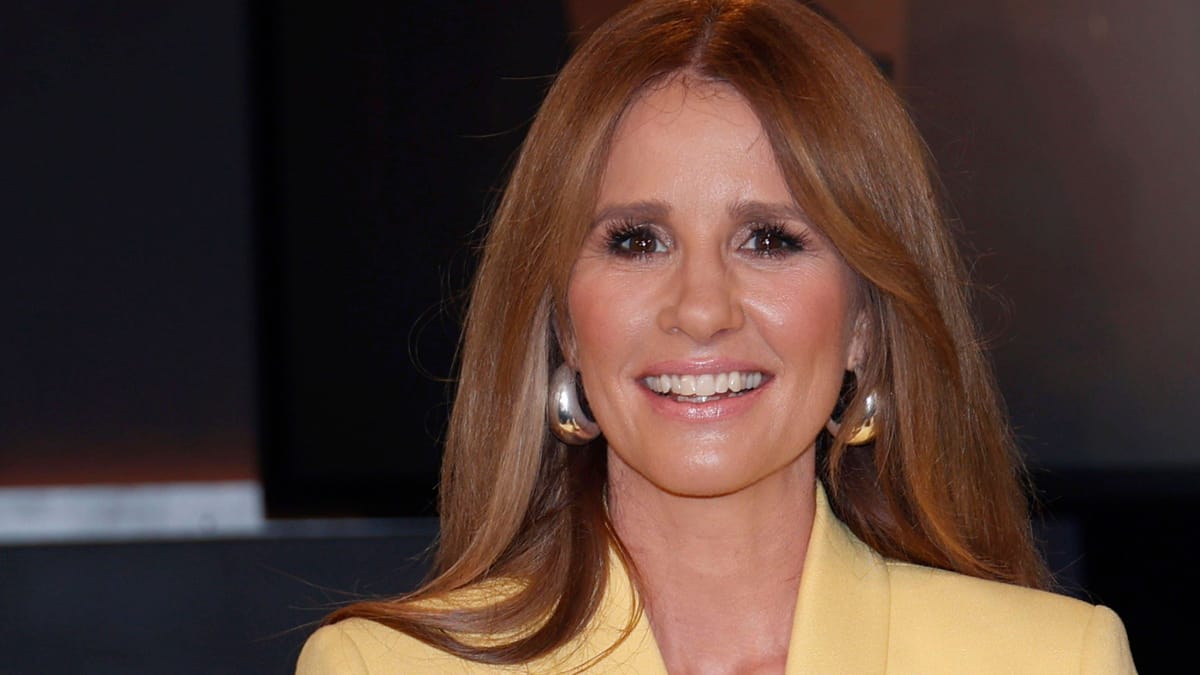Eine „Bild“-Geschichte über eine angeblich transsexuelle Polizistin entpuppt sich als gigantische Lüge. Fußte sie auf einer polizeiinternen Intrige? Jetzt äußert sich erstmals die in dem Fall angegriffene Gewerkschaft.
Schwarz auf Hellgrau, riesengroß, stundenlang an prominenter Position auf der Homepage: Am Donnerstag musste die „Bild“-Zeitung einräumen, eine komplette Artikelserie quasi herbeifantasiert zu haben.
„Richtigstellung Fall Judy S.“, stand in mächtigen Buchstaben auf der „Bild“-Internetseite. Und etwas kleiner darunter: „‚Bild‘ hat im November 2024 in mehreren aufeinanderfolgenden Berichten Falschbehauptungen über die Berliner Polizistin ‚Judy S.‘ verbreitet. Wir haben berichtet, dass Judy S. in Wirklichkeit eine Transfrau sei. Sie habe beim Sex in ihrer Wohnung zwei Männer unter Drogen gesetzt und missbraucht, unter anderem mit einer Penispumpe.“
Es war eine Geschichte, die bundesweit Wellen schlug. Die in sozialen Medien viral ging. Die den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt dazu trieb, Häme nicht nur über Judy S., sondern über trans Personen ganz allgemein auszugießen: „Wann merkt diese Gesellschaft, dass wir solche Leute nicht in die Umkleiden von Mädchen lassen dürfen?“, ätzte er auf der Plattform X. Und unzählige User fielen in sein anklagendes Johlen mit ein.
Allerdings, wie sich dann herausstellte: Es war alles erfunden, von Anfang bis Ende. Oder wie es in der von der „Bild“-Zeitung publizierten Richtigstellung zur eigenen Berichterstattung heißt: „Keine dieser Behauptungen war zutreffend. Sie sind widerlegt.“

Judy S. ist demnach also keine trans Frau. Sie ist als Mädchen zur Welt gekommen. Sie hat in ihrer Wohnung keine Männer beim Sex unter Drogen gesetzt. Und sie hat sie auch nicht mit einer Penispumpe missbraucht.
Es ist ein Fall, der das Zeug hat, zumindest die Glaubwürdigkeit von „Bild“, wenn nicht aller Medien in Deutschland generell zu gefährden. Wie konnte die „Bild“-Redaktion nur eine solche Artikelserie veröffentlichen, die ganz offensichtlich jeder Grundlage entbehrte?
Zunächst: Bei allem, was Medien in Deutschland vorgeworfen wird, bei allen Fehlern, die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich begehen – der Fall Judy S. ist eine Ausnahme. „In meiner ganzen beruflichen Laufbahn habe ich keinen derartigen Fall erlebt“, erklärte Christian Schertz, Deutschlands bekanntester Medienanwalt, dem „Tagesspiegel“. „Hier wurde eine Frau öffentlich diffamiert und zum Monster gemacht. Der neue Fall Katharina Blum.“
Schertz, der die Vertretung von Judy S. übernahm, vergleicht den Fall Judy S. also mit Heinrich Bölls Roman aus dem Jahr 1974. Die Romanfigur Katharina Blum gerät darin nach einer Nacht mit einem ihr bis dahin unbekannten Mann ins Mahlwerk einer Boulevardzeitung. Das Publikum erkannte in dieser Zeitung, die die Ehre der Katharina Blum im Buch systematisch zerfetzt, ganz eindeutig die „Bild“.
So monströs findet der Medienprofi Schertz den Fall Judy S. also, dass er ihn heute, 50 Jahre nach Bölls Buch, nicht mit einem realen Fall von Falschberichterstattung vergleicht, sondern mit dem Roman. Das ist bezeichnend.
Auch Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, hebt die Besonderheit des Falls hervor. Berichten zufolge haben sich „Bild“ und S. außergerichtlich auf eine Zahlung von 150.000 Euro geeinigt. Gostomzyk nennt das, gerade auch angesichts des außergerichtlichen Vergleichs, „eine stattliche, in Deutschland nicht alltägliche Summe“.


Die Artikelserie habe eine maximale Belastung für die betroffene Polizistin dargestellt: „Je größer die Auswirkung der Berichterstattung für einzelne Personen ist, desto sorgfältiger sollten Medien aus eigenem Interesse recherchieren“, sagt er t-online. In der Summe der vereinbarten Zahlung sei sicher auch ein Teil enthalten, der zur Abschreckung dienen solle: „Die Höhe der Geldzahlung soll der Betroffenen Genugtuung verschaffen, aber auch dazu führen, präventiv von vergleichbaren Verletzungen abzuhalten.“