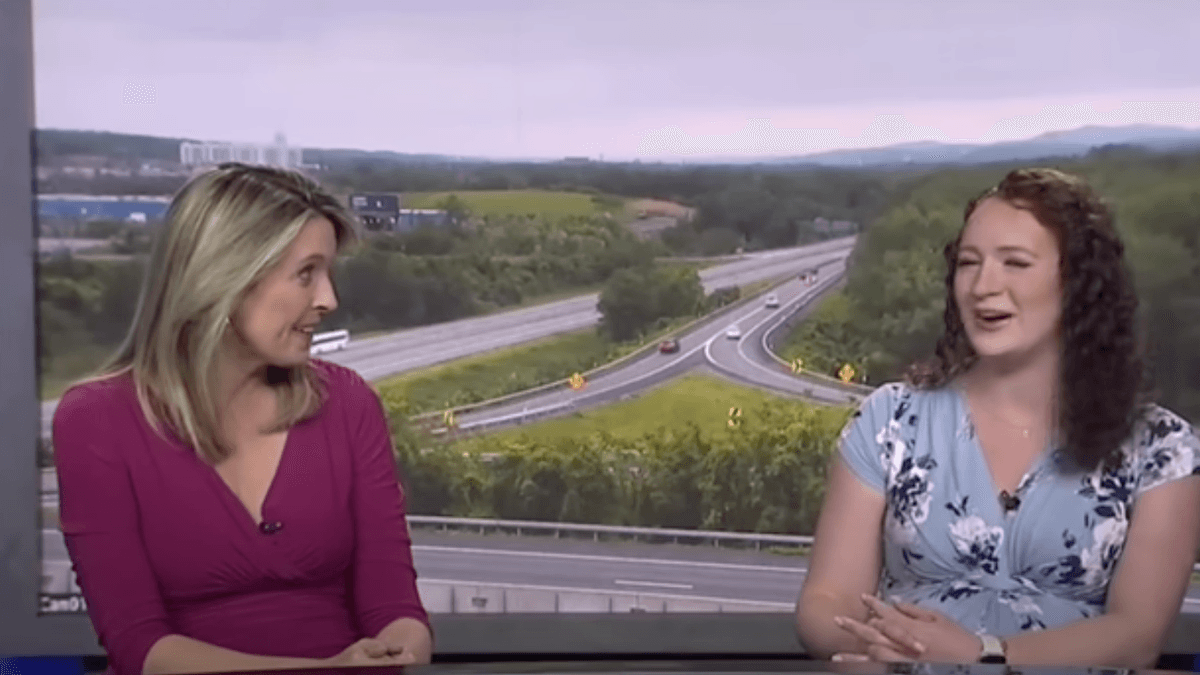Rolls Royce macht Mega-Gewinne, weil ihr Geschäft mit Flugzeugturbinen so gut läuft wie nie. Warum sollten einzelne dann auf den Urlaubsflug verzichten, wenn ihre Entscheidung offenbar keinen Unterschied macht?
Wenn ich Nachrichten aus der Flugbranche lese, habe ich manchmal das Gefühl, die Klimakrise gebe es gar nicht: „Weltweite Luftfahrt auf Kurs zu neuen Rekorden“, titelte das Statistikportal Statista im vergangenen Jahr. Der aktuelle Touristik-Report des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist mit dem folgenden Titel überschrieben: „Sommer 2025 – Touristischer Luftverkehr erholt sich weiter.“ Vergangene Woche vermeldete Rolls Royce Rekordzahlen. Grund ist nicht etwa die gestiegene Nachfrage nach Luxusautos, sondern ein Boom bei der Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken, die der Konzern ebenfalls herstellt. Die Zahl der Bestellungen ist 2024 um 13 Prozent gestiegen, die mit Rolls-Royce-Triebwerken geflogenen Stunden übertrafen das Niveau von 2019 – und damit die Zahlen, bevor die Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen die Branche in eine Krise stürzte.
Warum ich persönlich seit einigen Jahren auf Flüge verzichte, habe ich schon mal hier aufgeschrieben. Aber ich verstehe alle, die sich angesichts dieser Meldungen fragen: Was bringt es überhaupt, sich persönlich zu kasteien, wenn die anderen es offenbar nicht tun?
Es bringt einiges, behaupte ich. Und das zeigen auch die Zahlen.
Auch in Deutschland gibt es Unterschiede
Als ich 2018 meinen eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnete, stellte ich schnell fest: Flugreisen machten einen überraschend großen Anteil der Gesamtsumme aus, bei mir damals fast ein Drittel meiner Emissionen. Das Konzept des Fußabdrucks sehe ich mittlerweile kritisch, manchmal erweist es sich dennoch als nützlich, um die Verhältnisse zu veranschaulichen.

Statistisch verursacht jede und jeder Deutsche einen Ausstoß von 10,3 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn man den Export und den Import von Waren mit einberechnet. Laut Umweltbundesamt liegt er damit mehr als 60 Prozent über dem globalen Durchschnitt, er ist sogar mehr als viermal so hoch wie der von Menschen in Indien.
Aber auch in Deutschland gibt es Unterschiede. Zuletzt hatte das Umweltbundesamt die Zahlen 2016 erhoben. Die klimafreundlichsten zehn Prozent der Bevölkerung kommen demnach auf durchschnittlich sieben Tonnen CO2 pro Jahr, die zehn Prozent mit dem höchsten Ausstoß verursachen mehr als doppelt so viel: 17,7 Tonnen CO2 pro Jahr.
Wer fliegt, packt schnell ordentlich was drauf auf seine persönliche Bilanz. Ein Flug von Hamburg nach Mallorca und zurück verursacht laut dem führenden Kompensationsportal Atmosfair 0,6 Tonnen CO2. Ein einziger Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach New York verursacht mehr als drei Tonnen CO2 pro Person. Dafür könnte man ein Jahr lang in einem Mittelklassewagen herumfahren, oder sechs Mal von Flensburg nach Konstanz und zurück.
Flugreisende können mithilfe von Anbietern wie Atmosfair die Klimagase ihrer Flugreise kompensieren. Sie zahlen dafür freiwillig einen von den Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag, den das Portal dann dazu verwendet, erneuerbare Energien in Ländern auszubauen, wo es diese noch kaum gibt, also vor allem in Entwicklungsländern. Dadurch wird dann entsprechend CO2 eingespart.
Wie viele Emissionen pro Kopf global verbraucht werden dürften, lässt sich schwer berechnen. Lange geisterte die Zahl von zwei Tonnen pro Kopf durch den öffentlichen Diskurs, Atmosfair spricht von 1,5 Tonnen. Fakt ist, dass nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen, als kompensiert werden können, wenn die Erderhitzung nicht weiter steigen soll. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass der Zielwert bei deutlich unter einer Tonne CO2 pro Person und Jahr liegen muss, um das zu schaffen.
In Zeiten, in denen Regierungen – nicht nur in den USA – weniger Verantwortung übernehmen, kommt es daher umso mehr darauf an, was Bürger und Konsumenten konkret tun, oder eben: nicht tun. Und zumindest Urlaubsflüge sind Luxusemissionen. 2019 machte der Tourismus der Deutschen etwa 25 Prozent der Gesamtemissionen des Landes aus. Der Experte für Klima und Tourismus, Stefan Gössling, weist darauf hin, dass die Gesamtemissionen Deutschlands zwischen 2009 und 2019 zwar um 15 Prozent gesunken, im Tourismus aber um acht Prozent gestiegen sind.