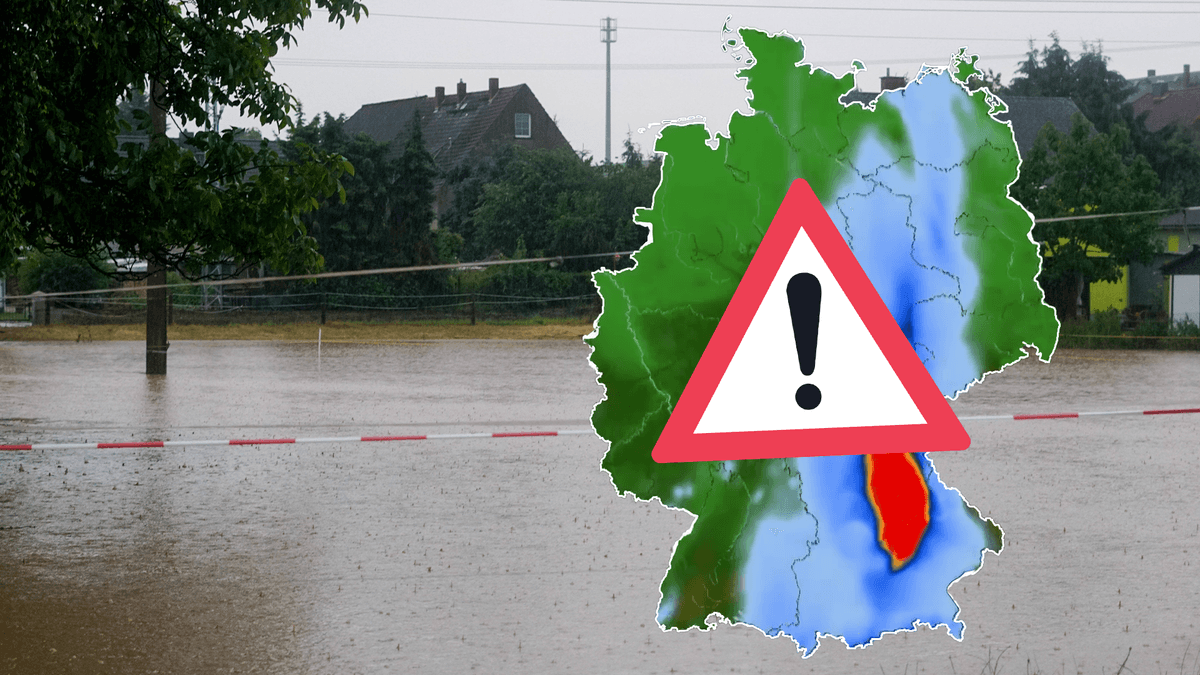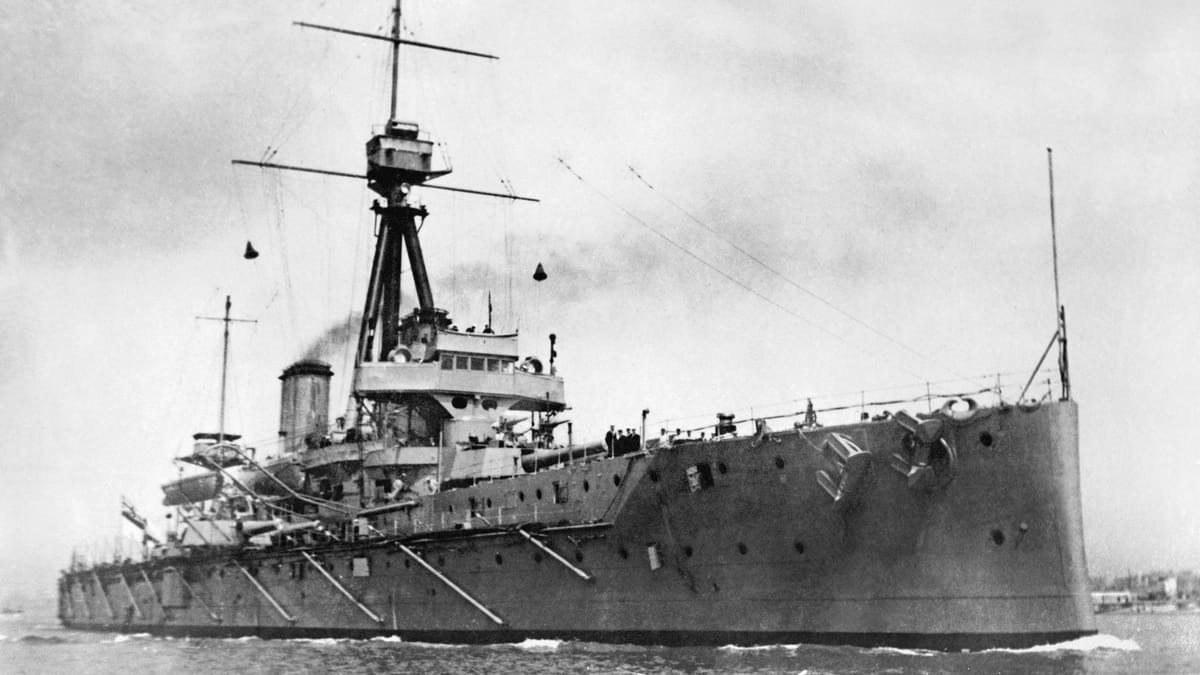Die Schattenwelt des Vatikans hat den Blick auf das nächste Konklave bereits lange vor dem Tod von Franziskus gerichtet. Das Ringen um die Zukunft hat begonnen, bevor sein Pontifikat beendet ist.
Im Vatikan tobt ein erbitterter Machtkampf – und das seit Jahren. Papst Franziskus hat die Kirche verändert, doch sein Erbe ist alles andere als gesichert. „Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erleben wir organisierte Gruppen in der Weltkirche, die gegen den Papst arbeiten“, sagt Vatikanexperte Marco Politi im Gespräch mit t-online. Ein innerkirchlicher „Bürgerkrieg“, wie er ihn nennt, spaltet die katholische Welt – geografisch, theologisch und ideologisch.
Und in diesem Krieg war Papst Franziskus der Mann im Fadenkreuz – ein Papst unter Wölfen. Seine Feinde saßen in der Kurie, im Kardinalskollegium, in mächtigen Netzwerken rund um den Globus.
Franziskus selbst wusste früh, worauf er sich einlässt. Der Widerstand gegen ihn begann bereits 2014 – genauer: bei der Familiensynode. Damals stellte der Papst eine jahrzehntealte Kirchenlehre infrage: Dürfen wiederverheiratete Geschiedene die Kommunion empfangen? Franziskus sagte Ja – und entfachte damit einen Sturm.
„Als die Ultrakonservativen merkten, dass Franziskus hier eine Neuerung anstoßen könnte – und dies dann auch tat –, organisierten sie sich“, erinnert sich Politi. Was folgte, war eine konzertierte Gegenoffensive: „Sie machten den Papst zum Feindbild, weil er angeblich von der ‚wahren Lehre‘ abweicht“, erklärt er.
- Aus Krisenregion an die Kirchenspitze? Er ist der Favorit auf die Papst-Nachfolge
- „Auf dem Sprungbrett für das Papstamt“: Der graue Kardinal
- Trauer um Franziskus: Das passiert nach dem Tod des Papstes
Franziskus war plötzlich nicht mehr nur spirituelles Oberhaupt – sondern Zielscheibe. „Man hat versucht, ihn moralisch zu demontieren“, so der Buchautor. „Und das geschah nicht irgendwo in dunklen Ecken, sondern aus den höchsten Etagen der Kirche.“
Die Strippenzieher des Widerstands waren keine Randfiguren – sie waren Schwergewichte der katholischen Welt. Unter ihnen: Raymond Leo Burke: ein amerikanischer Kardinal mit direktem Draht zu konservativen US-Medien und wohlhabenden Sponsoren; Joachim Meisner, der inzwischen verstorbene Kölner Kardinal, der sich offen gegen Franziskus stellte; Walter Brandmüller, deutscher Kirchenhistoriker und Verfechter der alten Ordnung; Gerhard Ludwig Müller, Ex-Chef der Glaubenskongregation, der vom Papst persönlich entlassen wurde.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Was diese Männer vereint: Sie sahen in Franziskus eine Gefahr – für die Dogmen, für die Disziplin, für die Machtstruktur, die ihnen jahrzehntelang vertraut war.
Marco Politi wurde 1947 in Rom geboren und gilt als einer der renommiertesten Vatikanexperten. Über 50 Jahre hinweg begleitete er die Pontifikate von Paul VI. bis Franziskus. Politi schrieb unter anderem 20 Jahre für die italienische Tageszeitung „La Repubblica“, später wechselte er zum „Fatto Quotidiano“. Gemeinsam mit dem amerikanischen Starjournalisten Carl Bernstein verfasste er eine politische Biografie des polnischen Papstes Johannes Paul II. 2012 veröffentlichte er die Monografie „Benedikt. Krise eines Pontifikats“. Es folgte „Franziskus unter Wölfen“ und 2020 „Das Franziskus-Komplott“. In dem Buch beschrieb Politi, welche konservativen Netzwerke, Kardinäle und Bischöfe im Vatikan und im Ausland Papst Franziskus bekämpfen.
Die katholische Kirche ist längst nicht mehr Rom-zentriert. Der Bürgerkrieg tobt heute auf mehreren Kontinenten – gleichzeitig, mit unterschiedlichen Frontlinien. In Nordamerika ist das Bischofskollegium gespalten: Ein Teil trägt den Reformkurs mit, der andere macht offen Stimmung gegen den Papst. In Afrika sind sich die Episkopate fast einig – aber gegen Franziskus. Besonders beim Thema Homosexualität verweigern sie jede Öffnung. In Osteuropa herrscht eiserner Konservatismus. In Westeuropa gibt es progressive Kräfte – doch sie sind leise, zurückhaltend, oft zögerlich.
Das hat dazu geführt, dass die Gegner von Franziskus ihn in entscheidenden Momenten ausbremsen konnten – etwa bei der Amazonas-Synode, als er verheirateten Priestern in entlegenen Regionen eine Perspektive eröffnen wollte. „Die konservativen Kräfte, darunter auch Benedikt XVI., intervenierten, und am Ende musste Franziskus zurückweichen“, schildert Politi die Entwicklung.


Die gleichzeitige Präsenz von zwei Päpsten – der eine im Ruhestand, der andere im Amt – hatte die ersten zehn Jahre des Pontifikats von Franziskus ohnehin erschwert. Franziskus hatte zunächst die Kardinäle, die er nicht selbst ernannt hatte und die nicht auf seiner Linie waren, auf ihren Kurienposten belassen – im Versuch, eine gute Beziehung zu Ratzinger aufrechtzuerhalten.
Als er vom Papstthron herabgestiegen war, hatte Ratzinger seinem Nachfolger „bedingungslose Ehrerbietung und Gehorsam“ versprochen. Doch er hielt sich nicht daran und schloss sich dem Lager der Erzkonservativen an. Erst nach dem Tod von Ratzinger 2023 konnte Franziskus zu einem Gegenschlag ausholen. Er entließ den Ex-Sekretär und Testamentsvollstrecker seines Vorgängers. „Es ist eine Demütigung vor aller Welt“, sagte damals der Entlassene.
Kardinal Burke ereilte die Strafe wenig später. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Kardinalpatron des Malteserordens wurden ihm Gehalt und Dienstwohnung gestrichen. Burke arbeite „gegen die Kirche und gegen das Papsttum“, um die Gemeinschaft zu spalten, hatte Franziskus im Vorfeld erklärt.